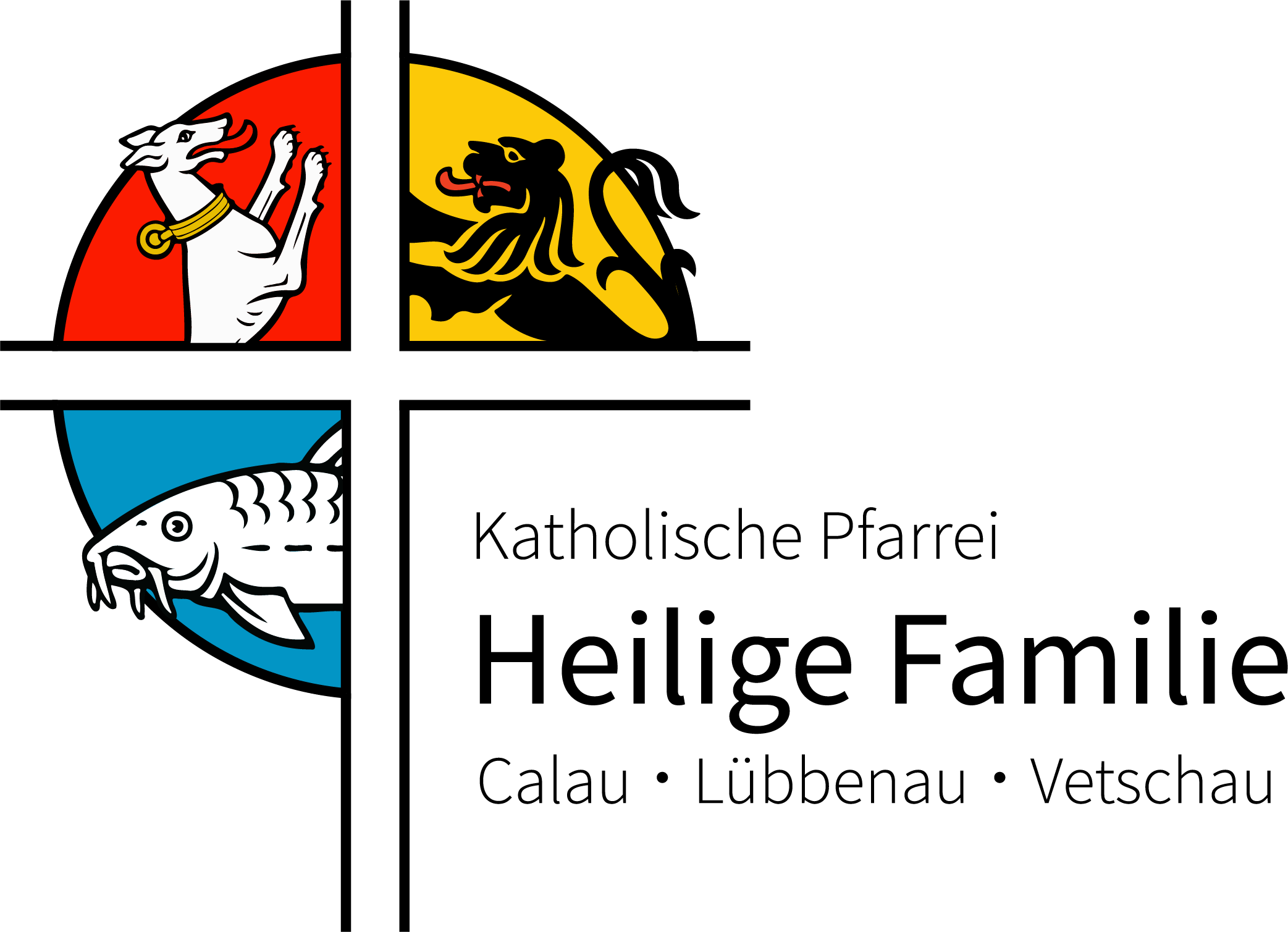Unter Heiden

Unser Autor ist katholisch. Früher war das kein Problem – aber heute wird er dafür ausgelacht und kritisiert. (von Tobias Haberl aus dem SZ Magazin, Foto: unsplash/kfred)
Diesen Text traue ich mich nur zu schreiben, weil ihn sowieso niemand liest. Ist doch heute so, dass man weghört oder aggressiv wird, wenn es um Glauben oder, noch schlimmer, die Kirche geht. Dass sich außer ein paar Zurückgebliebenen kein Mensch dafür interessiert. Dass man reflexhaft an fummelnde Priester denkt, und zwar ausschließlich. Dass sich viele darauf geeinigt haben, dass die Kirche böse ist, total von gestern, und unsere Welt eine bessere wäre, wenn man diese absurde Erfindung verlogener weißer Männer endlich abschaffen könnte.
Ich meine nicht die Menschen, die aus der Kirche austreten, allein 2021 waren es in Deutschland 640.000, voriges Jahr sollen es mehr gewesen sein, es liegen noch nicht alle offiziellen Zahlen vor. Nach allem, was geschehen und nicht geschehen ist, kann ich diesen Schritt nachvollziehen. Sondern ich meine die zynischen Schenkelklopfer, die in Papst Benedikts Sterbestunde viral gingen. In einem wurde sein ledriges Gesicht mit einem in der Schultasche vergessenen Pausenbrot verglichen. Ich meine die ungläubig-angewiderten Blicke, die einen treffen, wenn man erklärt, dass man am Sonntagvormittag leider nicht in dieses neue Café zum Frühstücken kommen kann, weil einem der Besuch der Heiligen Messe wichtiger ist. Ich meine, dass man sich, nur weil man zu spüren meint, dass dem spätmodernen Menschen in seiner Haltlosigkeit so etwas wie göttlicher Trost gut täte, anschauen lassen muss, als hätte man Kampfjets gefordert, und zwar für Russland. Ich meine, dass im Koalitionsvertrag der Ampelregierung die Buchstabenfolge »Christ« auf 178 Seiten nur ein einziges Mal vorkommt – in der Unterschrift des Finanzministers.
Neulich ließ ich in einem Gespräch mit einem Bekannten das Wort »Eucharistie« fallen. Er sah mich irritiert an: Eucharistie?! Ich könne nicht davon ausgehen, dass normale Menschen wüssten, was das ist. Ich war ein bisschen geschockt, inzwischen versuche ich zu akzeptieren, dass Gott, Glaube und Kirche in meinem Umfeld praktisch keine Rolle spielen. Und das Abendmahl schon gar nicht. Dass ich sowohl in meiner Nachbarschaft (gentrifiziertes Bullerbü-Viertel) als auch in meiner Branche (irgendwas mit Medien) von Menschen umzingelt bin, die sich entweder nicht oder verächtlich über Religion äußern. Menschen, die Toleranz gegenüber Minderheiten fordern, aber meinen Glauben selbstverständlich verunglimpfen, indem sie ihn auf seine problematischen Aspekte oder Verfehlungen Einzelner reduzieren. Menschen, die bei jeder Gelegenheit Diversität fordern, aber verkennen, dass ein Gottesdienst um ein Vielfaches diverser besetzt ist als jede ihrer Partys, auf denen immer alle die gleichen Netflix-Serien schauen. Menschen, die an technischen Fortschritt, Instagram, Self-Care, Hyaluron-Filler, Mental Health und Nachhaltigkeitsfonds glauben, nur eben nicht an Gott. Ob sie ahnen, dass es mir genau andersherum geht? Dass mir fast alles, worauf sie zählen, hohl und fragwürdig erscheint, während ich von der Liebe Gottes immer noch überzeugter bin?
Die kürzeste Definition von Religion ist Unterbrechung. So hat es der katholische Theologe Johann Baptist Metz 1977 formuliert. Es ist tatsächlich so, dass ich mich, wenn ich nicht zu Hause hocken, aber niemandem begegnen will, an einem gewöhnlichen Dienstagabend in eine Kirche setze. Die Wahrscheinlichkeit, in einen Smalltalk mit einem der üblichen Bescheidwisser hineingezogen zu werden, liegt bei exakt null Prozent, weil die immer in einem Meeting oder im Internet sind. Fast immer bin ich der Einzige, manchmal kniet ein Mütterchen mit Plastiktüte vor mir, manchmal spielt jemand Orgel. Meistens bleibe ich nur ein paar Minuten, mein Handy auf lautlos geschaltet, sauge die steinerne Kühle ein, die letzten Weihrauchreste, und kann nicht fassen, dass sich fast niemand nach dieser Pracht, nach dieser Atmosphäre sehnt, danach, für ein paar Minuten unbelästigt zu sein. Ich werfe 50 Cent in den Opferstock, zünde eine Kerze an, bete, denke nach, betrachte eine Heiligenstatue, um dann wundersam erfrischt nach draußen zu treten, in den Verkehr und den Stress – was man halt so Freiheit nennt. Erst dann fällt mir wieder ein, dass es für viele Menschen heute wenig Schlimmeres gibt als Stille, die Abwesenheit von Whatsapp- und Push-Nachrichten, weil dann Fragen auftauchen, deren Antwort sie nicht googeln können.
Eine Zeit lang habe ich mich als gläubiger, erst recht katholischer Mensch, die ja bekanntlich die schlimmsten sind, als Sonderling gefühlt. Das ist vorbei. Inzwischen komme ich mir wie ein Verschwörungstheoretiker vor, der Dinge glaubt, die von den meisten anderen nicht geglaubt werden, weil sie sie für wissenschaftlich widerlegt halten, weshalb sie einen belächeln, bemitleiden oder verachten. Manche wollen immerhin diskutieren, verfügen aber oft nur über eine starke Meinung, dafür über wenig Interesse, geschweige denn theologisches Wissen. Ein Freund war regelrecht perplex, als ich in einem Gespräch über den Islam erwähnte, dass Muslime und Christen selbstverständlich denselben Gott anbeten, dass Allah lediglich das arabische Wort für Gott ist.
Meinen Glauben nehmen diese Menschen ausschließlich über Signalwörter aus den Medien wahr: Missbrauch, Diskriminierung, Zölibat, Frauenpriestertum. Oft denken sie nur an die Sünder und nicht an die Heiligen, reduzieren die Kirche auf die mächtigen Männer in den scharlachroten Soutanen und vergessen, dass sie von jedem einzelnen Getauften repräsentiert wird. Sie fordern, dass die Kirche zeitgemäßer werden muss, begreifen aber nicht, wie kompliziert das ist, weil ihre Kraft doch gerade in der Differenz zum Zeitgeist liegt, weil sie überfordern muss, um nicht banal zu werden. Was mir bei diesen Menschen fehlt, ist die Fantasie, sich so etwas wie eine göttliche Offenbarung wenigstens vorzustellen. Dass es Zusammenhänge gibt, die nicht von dieser Welt sind, ja dass vielleicht sogar stimmen könnte, was Robert Musil in seinem Roman Der Mann ohne Eigenschaften geschrieben hat: dass es kein großes Glück ohne große Verbote gibt. Viele verwechseln die Kirche mit einem Sozialverein und sind ganz verdutzt, wenn man ihnen erklärt, dass es schon auch darum geht, bedürftigen Menschen zu helfen, aber in erster Linie darum, Christus zu vergegenwärtigen. Es ist, als würde man sich zum Tennisspielen verabreden, und das Gegenüber erscheint mit Schwimmflossen statt einem Schläger. Als amüsant empfinde ich Menschen, die mir erklären wollen, dass Gott eine Frau ist, weil ich die Idee, dass Gott ein Geschlecht haben könnte, schon wieder rührend finde. Andere verbreiten diskriminierende Falschmeldungen (»75 Prozent aller katholischen Priester sind pädophil«) und lächeln dabei, nach dem Motto: Du weißt schon, wie es gemeint ist. Problem: Ich weiß tatsächlich, wie es gemeint ist.
Und das alles wäre nur lästig, aber keine masochistische Angelegenheit, wenn ich mich nicht deutlich daran erinnern könnte, dass es in meiner Kindheit andersherum war. Da nämlich wurde über die getuschelt, die nicht in der Kirche waren oder beim Kartenspielen im Wirtshaus »Kruzifix« fluchten. Jeden Sonntagmorgen strömten die Menschen in die Stadtpfarrkirche, eine von Glockenläuten untermalte Choreografie der Frömmigkeit, und klar waren da auch Heuchler dabei, und zur Verklärung neige ich auch, aber ich meine, es lag eine Vorfreude, ein Gemeinschaftsgefühl, ein ahnungsvolles Flirren in der Luft. Gott war damals ein selbstverständlicher Bestandteil meines Lebens, vielleicht nicht das Zentrum, aber ein Faktor. Dass es Menschen geben könnte, die nicht an ihn glauben, konnte ich mir gar nicht vorstellen.
Ich war ein frommer Junge, der jeden Abend betete, am Mittwoch den Kindergottesdienst und am Sonntag die Heilige Messe besuchte. Vor meiner Erstkommunion notierte ich jede Sünde, die ich begangen zu haben meinte. Ich weiß noch, wie erwartungsvoll ich vor unserem Stadtpfarrer niederkniete, um zum ersten Mal den Leib Christi zu empfangen (Eucharistie!). Die Sonn- und Feiertage, die Heiligengeschichten, die Kirchenlieder, die Prozessionen, die Weihnachts- und Osterfeste, sogar die Sterbebildchen und Begräbnisse – ich fühlte mich eingebettet und gehalten, mein Leben hatte einen Sockel und ein Dach, Sinn und Rhythmus, alles hatte seine Zeit, die Freude, aber auch die Trauer, wenn wir an Allerheiligen am Grab der Großeltern standen, mein Vater im bodenlangen Mantel, ich fröstelnd im Nieselregen. Und ich weiß noch, dass ich mich innerlich weggewünscht, aber gleichzeitig gespürt habe, dass es wichtig ist, hier zu stehen und zu erkennen, woher ich komme und wohin ich gehe, dass also auch ich: Staub bin.
Ich habe darüber nachgedacht, ob ich negative Erlebnisse verdrängt habe, aber außer einem Religionslehrer, der mir auffallend oft über den Kopf streichelte, ist mir nichts eingefallen. Und auch wenn man sich das kaum noch vorstellen kann: Ich war damals, in den Achtzigerjahren auf dem Land, keine Ausnahme. Praktisch alle machten das so: Ich traf meine Kumpels nicht nur, aber auch in der Kirche, mein bester Freund kam jeden Sonntag um zwei vor zehn mit seinem Mountainbike auf den Kirchplatz geradelt, nicht um Gott, sondern um meiner Cousine zu huldigen, aber davon rede ich ja: Das schönste Mädchen der Stadt saß eben auch in der Kirche.
Inzwischen haben sich die Dinge in ihr Gegenteil verkehrt: Viele Menschen strömen nicht mehr in die Kirchen, sondern in Apple-Stores, sie wollen keine frohe Botschaft, sie wollen das neue Smartphone. Es war immer fordernd, katholisch zu sein – wer betet schon gern für seine Feinde? –, aber im Moment ist es besonders anstrengend. Ständig soll man sich rechtfertigen oder schämen, als würde man selbst nicht am meisten darunter leiden, wenn Priester ihre Gelübde brechen, wenn Kirche nicht mehr das ist, was sie sein könnte, nämlich eine vertrauenswürdige Institution und ein Mysterium. Gerade verriet mir eine Kollegin, dass sie ihren Glauben inzwischen »eher verheimlicht«, ich habe von Kirchenmitarbeitern gehört, die auf die Frage nach ihrem Beruf angeben, für eine »wohlfahrtsstaatliche Einrichtung« tätig zu sein.
Ich ahne, warum sie das tun, aber Verheimlichen kommt nicht infrage. Und wenn ich am Sonntagabend, bevor ich zur Theatinerkirche spaziere, die guten Schuhe anziehe, meine Wohnungstür einen Spalt öffne und kurz ins Treppenhaus horche, ob auch wirklich niemand seinen Papiermüll nach unten bringt, geschieht es nicht aus Feigheit, sondern weil ich keine Lust auf würdelose Gespräche habe; nicht dass mich am Ende noch jemand interessant oder, noch schlimmer, mutig findet. Ich weiß doch, wie Nachbarn sind, erst recht, wenn gleich der Tatort anfängt. »Oha, du siehst aber schick aus! Wohin geht’s denn?«, fragen sie, und ich würde natürlich die Wahrheit sagen (8. Gebot), und schon muss man sich Meinungen anhören, um die man nie gebeten hat.
Als ich zwölf war, im Jahr 1987, waren knapp 85 Prozent der Deutschen Mitglied einer christlichen Kirche. Inzwischen sind es weniger als die Hälfte. Das sind immer noch Millionen, aber die meisten Menschen, mit denen ich jeden Tag konferiere, telefoniere, diskutiere oder in der Kneipe sitze, gehören nicht dazu. Christlich sein, das ist von einer (gefühlten) Selbstverständlichkeit zu einer von zahllosen Identitäten geworden, mit denen Menschen sich selbst etikettieren:
Der eine ist Veganer, die andere Klimaschützerin, der nächste Katholik. Es ist ein eigentümliches Gefühl, von einer Mehrheit zu einer Minderheit zu werden, vom Mainstream zur Randgruppe, vom Konformisten zum Dissidenten – und alles, nicht weil ich mich, sondern weil die Welt sich verändert hat. »Crux stat dum volvitur orbis« (Das Kreuz steht fest, während die Erde sich dreht), lautet der Wahlspruch des Karthäuserordens. Darin liegt auch eine Gefahr, weil Stabilität zu Erstarrung, Erstarrung zu Verbitterung und Verbitterung zu Radikalisierung führen kann. Nichts wäre tragischer, als sich im Namen des Glaubens in die Totalopposition zu verabschieden. Lieber lasse ich mich bestaunen wie ein seltenes Tier im Zoo und bleibe im Gespräch, nicht obwohl, sondern weil mich einige nicht für ganz voll nehmen. Wahr ist auch: Wer glaubt, braucht die anderen gar nicht.
Einerseits wähnt man sich im Besitz eines Schatzes, den man gern mit anderen teilen würde (man will ja auch sie erlöst wissen), andererseits wird man, weil man unter der spirituell ausgezehrten Gegenwart leidet, weil man nicht an die Segnungen des technischen Fortschritts, sondern an das ewige Leben glaubt, mit Häme überzogen. Einerseits wird man unsicher, andererseits trotzig: Jetzt erst recht, sagt man sich. Es ist das Grundgefühl vieler konservativer Menschen, die nicht begreifen, warum sie in einer aller Tradition entleerten Gesellschaft auf einmal als problematisch wahrgenommen werden, warum ihre Sehnsucht nach christlichen Werten (hinter denen keine Interessen stecken) automatisch als patriarchal gebrandmarkt wird. Da versucht man, ein guter Mensch zu sein – und, schwups, ist man ein fragwürdiger Rechtsausleger, und alles nur, weil man Barmherzigkeit und Nächstenliebe schlüssiger findet als zur Schau gestellte Moral, weil man sich nicht permanent vor der Twitter-Gemeinde, sondern am jüngsten Tag vor seinem Schöpfer rechtfertigen will, der nicht nur die Timeline, sondern auch das Verborgene sieht.
Was mir zu schaffen macht, ist, dass man als Katholik von Menschen angegriffen wird, die sich weigern, sich mit der Logik meines Glaubens auseinanderzusetzen, die empört den Kopf schütteln, wenn man ihnen erklärt, dass man nicht nur für die Missbrauchsopfer, sondern auch für die Täter beten sollte, weil die in theologischer Sicht das größere Problem haben. Manchmal habe ich das Gefühl, als riefe ich von der einen Seite eines Grabens auf die andere, aber keiner hört mehr zu, und wenn doch, versteht mich niemand mehr oder absichtlich falsch. Zum Beispiel gibt es in meinem Umfeld viele Menschen, für die ein Schwangerschaftsabbruch eine unter allen Umständen zu gewährende Dienstleistung ist. Und ich bin kein Abtreibungsgegner, Schwangerschaftsabbrüche sollen unter bestimmten Bedingungen möglich sein, trotzdem bin ich – nicht als katholischer, sondern einfach nur als Mensch – jedes Mal wieder erschrocken, wenn ich mitkriege, wie manche inzwischen über dieses Thema sprechen, nämlich in einem Jargon, als ließe man mal eben einen Leberfleck entfernen, um sich besser auf die nächste Klausur konzentrieren zu können. Und dass es für so ein Bekenntnis heute Mut braucht, dass es mit großer Wahrscheinlichkeit einen Shitstorm zur Folge hat, wenn man tastend darauf hinweist, dass hier kein Zellhaufen, sondern ein Mensch heranwächst, dessen Herz womöglich schon schlägt, der aber noch keine Stimme hat, um seine Lust auf die eigene Geburt zu artikulieren, darüber kann man gar nicht genug verzweifeln.
Viele Menschen können sich nicht mehr vorstellen, dass ein Kreuz für etwas anderes als Spaltung oder Diskriminierung stehen könnte. Dies wurde deutlich, als das Auswärtige Amt anlässlich des G7-Gipfels das 482 Jahre alte Kreuz aus dem historischen Friedenssaal im Münsteraner Rathaus entfernen ließ, laut Aussage der Stadt, »weil Menschen verschiedener Kulturen teilnehmen«. Tatsächlich wurden in diesem Raum nicht nur der Dreißigjährige Krieg beendet und der Westfälische Frieden geschlossen, es kam auch zu einem Religionsfrieden zwischen Protestanten und Katholiken, zu Aussöhnung und Vergebung. Könnte es ein besseres Symbol für Verständigung geben? Und kann man bei nicht christlichen Gipfelteilnehmern nicht Respekt voraussetzen, womöglich Vorfreude, sich von solchen historischen Zusammenhängen bereichern zu lassen? Japan jedenfalls hat beim G7-Gipfel auf heimischem Boden seine Gäste ganz selbstverständlich dazu eingeladen, den Ise-Schrein zu besuchen, die Heimat der Sonnengöttin, die als Ahnherrin der japanischen Kaiser verehrt wird.
Ich bekenne, dass mir Menschen, die an irgendwas glauben, und sei es eine Fruchtbarkeitsgöttin, viel näher sind als Menschen, die an nichts glauben. Nur Atheisten oder Fundamentalisten kommen auf die Idee, dass ich mich von Andersgläubigen gestört fühlen könnte. Im Gegenteil: Religiöser Pluralismus ist ein großer Schatz, den man nicht aus falsch verstandener Rücksicht verstecken, sondern selbstbewusst herzeigen sollte. Für die einen ist der Sonntag heilig, für andere der Freitag oder der Samstag, für wieder andere eine Kuh – ist das nicht herrlich? Also, ich fühle mich bereichert, wenn ich Juden, Muslime oder Buddhisten bei der Ausübung ihrer Religion beobachten darf, in Istanbul oder Kairo kann ich es gar nicht erwarten, die erste Moschee zu betreten. Nie werde ich den Moment vergessen, in dem ich die Frau, die ich liebe, zum ersten Mal in einem buddhistischen Tempel beobachtet habe, wie sie, ein Bündel Räucherstäbchen in Händen, den Kopf sachte auf und ab bewegend, Wünsche murmelte. Danach war sie nicht mehr dieselbe für mich – gerade weil sie etwas tat, was mir fremd ist, rückten wir näher zusammen, denn wir glauben unterschiedlich, sind uns aber einig darin, dass unser Leben nicht nur zum Spaßhaben da ist, sondern eine Vorbereitung, ja Prüfung darstellt für alles, was danach kommt. Eine Erfahrung, die ich regelmäßig mache: dass vermeintliche Atheisten nach dem dritten Gin Tonic mit einem Geständnis um die Ecke biegen. »Irgendwie beneide ich dich«, sagen sie: »Ich würde so gern glauben, aber schaffe es nicht.« Erstaunlich, denke ich dann oft, weil ich weiß, wie leichtgläubig sie sonst sind, wenn man ihnen weismacht, dass ihr Glück in digitalen Tools liegt. Trotzdem empfinde ich keine Schadenfreude, eher Mitleid und Bewunderung: Wie mutig muss man sein, ohne Hoffnung auf Erlösung durch eine Welt zu gehen, die auf permanente Steigerung angelegt ist? Wie tapfer, wenn man die Angst, über die niemand spricht, die aber doch jeder kennt, nicht lindern kann, indem man einen Psalm vor sich hinmurmelt (»Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück; denn du bist bei mir«)? Ich könnte das nicht, so stark bin ich nicht. Und dann spüre ich eben, dass die anderen es auch nicht sind, ja dass es eigentlich niemand ist, dass unsere Fixierung auf Rationalität und Technologie eine schmerzliche Lücke aufweist, weil Google jede Frage beantworten kann – nur nicht, wozu wir leben und was uns Halt gibt.